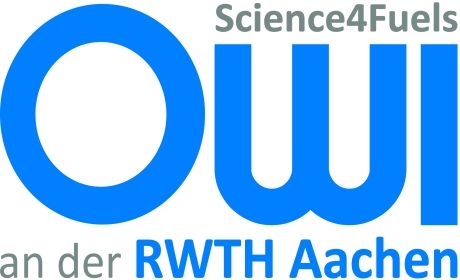Ablagerungsbildung in Brennerbauteilen bei Nutzung von E-Fuel Mischungen
Vermeidung von Alterungsprodukten und Ablagerungen von E-Fuels als Drop-In-Komponenten in Heizöl in Bauteilen von Brennersystemen im No-Harm-Prüfstand
Im Rahmen der Verwendung von alternativen Brennstoffen wird zurzeit eine Norm für paraffinische Brennstoffe entwickelt. Ein Vertreter dieser Gruppe sind Produkte Fischer-Tropsch-Synthese, die aus regenerativem Wasserstoff und einer Kohlenstoffquelle hergestellt werden. Da der Wasserstoff aus Elektrolyse über die Verwendung überschüssigen Stroms aus Wind- und Solarenergie gewonnen wird, spricht man auch von E-Fuels. Um solche paraffinischen Fuels sicher und ohne Ausfälle einzusetzen, müssen zuvor einige Untersuchungen durchgeführt werden. Zum einen ist nicht klar, ob in Mischungen mit konventionellem Heizöl Ablagerungsbildung auftritt, und zum anderen, wie solche Ablagerungen verhindert werden können. Gerade in Bezug auf die unterschiedliche Polarität der Komponenten kann es bei Alterung zu schnellerem Ausfallen von Sedimenten kommen. Diese können in Filtern hängen bleiben und diese dadurch verstopfen.
In diesem Forschungsprojekt sollen die Einflüsse von E-Fuels (GtL und HVO) in Blends mit Heizölen und Dieselkraftstoffen auf die Alterung und Ablagerungsbildung untersucht werden. Die Bedingungen zur Bildung von solchen Ablagerungen sollen abgeklärt werden, die entstandenen Ablagerungen eingehend zu untersuchen, und Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Die Ansätze reichen dabei von Veränderungen der Strömungsverhältnisse in Bauteilen, über die Zugabe von Additiven als besonderer Fokus, bis hin zur Vermeidung bestimmter Mischungsverhältnisse beim Nachtanken.

Unter erhöhter Temperatur, Licht, Druck und dem Einfluss katalytischer Metalle, sowie kritischer Mischungsverhältnisse der eingesetzten Blends können in technischen Heizölbrennern Ablagerungen entstehen. Es gibt jedoch in jedem Fall Kontakt mit der Oberfläche von Brennerbauteilen, Hitze an der Düse durch die Verbrennung, sowie erhöhten Druck in der Leitung von der Pumpe zur Düse. Bei diesen Randbedingungen werden verschiedene Bauteile von Brennern wie Filter, Pumpen, Ölvorwärmer und Düsen im anwendungsnahen Prüfstand wie No-Harm mit Brennstoffen in Kontakt gebracht. Dabei wird der Brennstoff in allen Fällen im Kreis geführt, um ein reales System nachzubilden. Die entstehenden Ablagerungen und die Alterung der Brennstoffe im Kontakt mit den Bauteilen werden im Anschluss näher untersucht.
Dann werden Additive eingesetzt, und die Lösungseigenschaften untersucht, sowie die Effektivität bei der Vermeidung der Ablagerungen. Zudem soll für reine E-Fuels die Kompatibilität mit den eingesetzten Additiven geprüft werden.
Im Anschluss an die Erzeugung der Ablagerungen werden diese mithilfe verschiedener Methoden näher untersucht. Es werden sowohl Standardanalysen wie Wassergehalt und Parameter wie Dichte und Viskosität bestimmt, als auch unterschiedliche Detailanalytik. Unter anderem sollen Ablagerungen mit TGA, DSC, GC, IR und vor allem auch NMR untersucht werden. Mithilfe der NMR und mit IR lassen sich Rückschlüsse auf beteiligte Stoffgruppen in den Ablagerungen schließen. TGA und DSC erlauben Einblick in das Temperaturverhalten der Ablagerungen. GC erlaubt die Aufschlüsselung in Bezug auf Polarität und Molekülgröße.
Aufgaben OWI
- Durchführung der experimenteller Alterungsuntersuchungen im anwendungsnahen No-Harm Prüfstand unter extremen Bedingungen und mit Additiven
- Charakterisierung der Ablagerungsbildung von verschiedenen Bauteilen
- Analytik der Brennstoffe und der Ablagerungen mittels Standardanalytik
- Ableitung einer Korrelation der Analysenergebnisse aus Standardanalytik und Detailanalytik.
Durchführende Forschungsstellen
- OWI Science for Fuels gGmbH
- ITMC RWTH Aachen University
Projektförderung
Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung unter dem Förderkennzeichen Nr. 22790 N gefördert. Innerhalb der industriellen Gemeinschaftsforschung war das Projekt bei der Forschungsvereinigung DGMK (Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreisläufe e.V.) angesiedelt. Die Laufzeit war von März 2023 bis August 2025 (30 Monate).